Politik | Zweiter Bericht des Kantonalen Jugendobservatoriums
Mit Verbesserungen die Jugendpolitik stärken
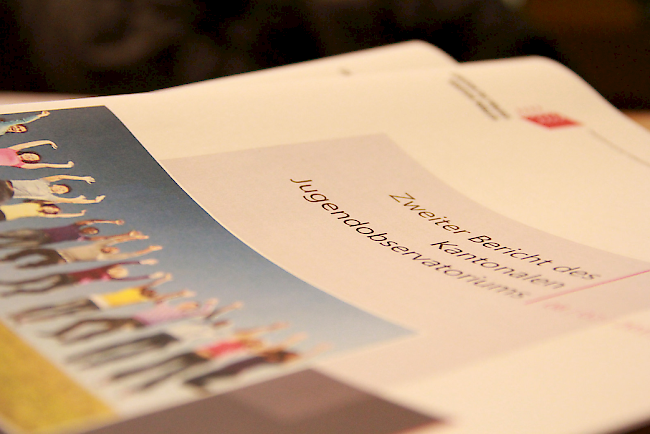
Die Jugendpolitik des Kantons soll effizienter werden.
Foto: zvg
Das Kantonale Jugendobservatorium veröffentlicht einen Bericht zu den beiden Themen «Platz der Kinder bei einer Trennung oder Scheidung» sowie «Betreuung und Eingliederung von Jugendlichen aus dem Asylbereich». Ziel ist es, die Lage und die Bedürfnisse der Jugendlichen im Wallis besser zu kennen und die Umsetzung einer effizienteren Jugendpolitik zu gewährleisten.
Das Kantonale Jugendobservatorium hat den Auftrag, allgemeine Fragen rund um die Unterstützung von Kindern, die Verbesserung der Jugendpolitik, die Vernetzung von Fachleuten oder aber Stützen für die Umsetzung einer Jugendpolitik basierend auf objektiven Daten zu prüfen. Im Rahmen seines zweiten Berichts hat sich das Kantonale Jugendobservatorium für zwei Themen interessiert, um die Lage und die Bedürfnisse der Jugendlichen im Wallis besser kennenzulernen und entsprechend handeln zu können.
Das erste Thema betrifft den Platz der Kinder bei einer Trennung oder Scheidung. Jedes Jahr seien im Wallis mehr als 500 Kinder mit der Scheidung ihrer Eltern konfrontiert, Tendenz steigend. Das zweite Thema betrifft die Betreuung und Eingliederung von Jugendlichen aus dem Asylbereich. Auch hier ist der Anteil Jugendlicher gross.
Ende 2016 empfing das Wallis 132 unbegleitete Minderjährige. Die Themen wurden in Zusammenarbeit mit den dreissig Mitgliedern der Expertengruppe des Observatoriums und mit der wissenschaftlichen Unterstützung der Universität Genf durch das interfakultäre Zentrum für die Rechte des Kindes (Centre interfacultaire en droits de l’enfant - CIDE) ausgewählt. Nach der Bestandsaufnahme betreffend Lage und Bedürfnisse der Jugendlichen im Wallis, erarbeitete das Kantonale Jugendobservatorium zwölf Empfehlungen für die politischen Akteure und Entscheidungsträger.
Unter Berücksichtigung der markanten Zunahme der Anzahl Trennungen und Scheidungen in den letzten Jahrzehnten sind Kinder einem höheren Risiko ausgesetzt, im Falle eines Konflikts, der nicht der ihre ist, als Geisel genommen zu werden. Für die Minderheit der Paare, die nicht in der Lage sind zu kooperieren, und im Interesse des Kindes, werden unter anderen folgende Denkanstösse gegeben: die systematische Ernennung eines Beistands für das Kind im Falle eines Konflikts, eine bessere Information der Eltern über ihre Rechte und Pflichten oder aber die Entwicklung von Modellen anhand von guten Beispielen aus der Praxis, um Elternkonflikten vorzubeugen oder sie einzudämmen.
In Bezug auf das zweite aufgegriffene Thema können diese Verbesserungen namentlich durch den Aufbau eines Netzwerks von Patinnen und Paten für unbegleitete Minderjährige, die Festlegung von offiziellen Quoten für die Ausstattung an Betreuungspersonal für Jugendliche sowie den Ausbau der Mittel, um auf die psychischen Bedürfnisse von Personen aus dem Asylbereich reagieren zu können.
Für beide Themen wurde zum Schluss auf die Wichtigkeit der Einführung einer systematischen Datensammlung hingewiesen, um sich der Lage der Kinder und Jugendlichen in geeigneter Art und Weise bewusst zu werden. Dank diesen Empfehlungen können die Akteure aus dem Bereich Kinder und Jugend den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Denkanstössen Folge leisten und sich dabei auf konkrete Informationen aus der Bedürfnisanalyse an der Front stützen.
pd/noa












Artikel
Kommentare
Noch kein Kommentar